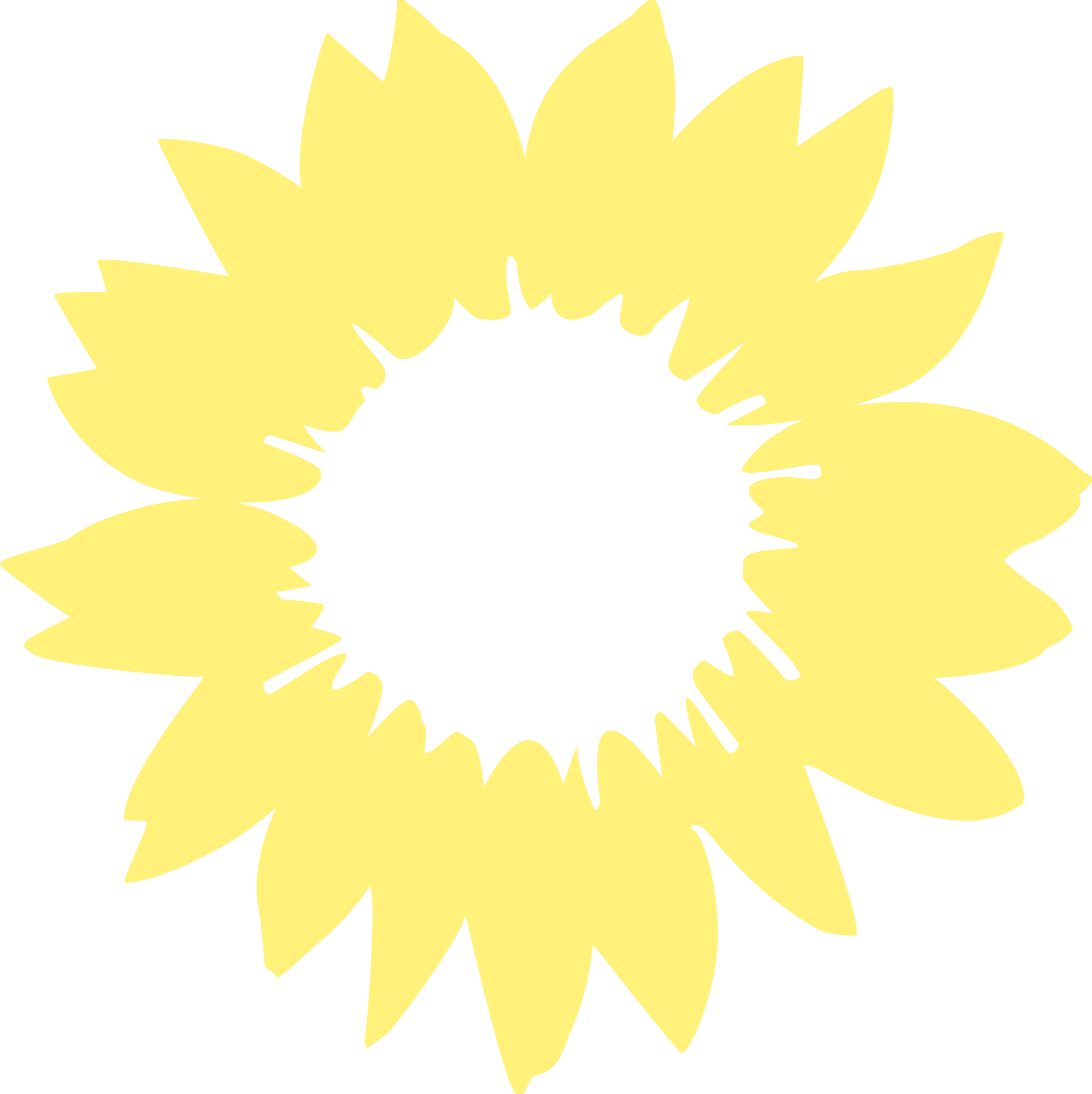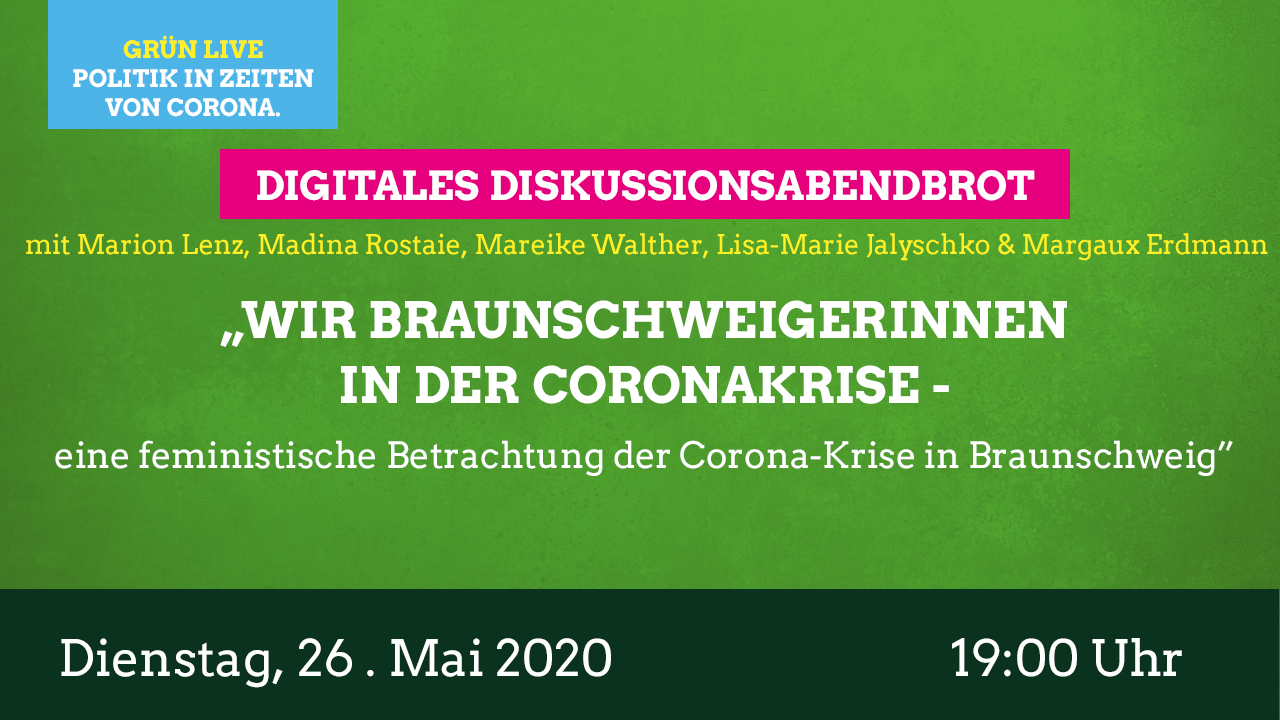Die Coronakrise ist eine feministische Krise! Denn insbesondere Frauen stemmen die Anforderungen, indem sie systemrelevanten und gleichzeitig schlecht bezahlten Jobs nachgehen und Mehrfachbelastungen wie Kinderbetreuung im Home Office aushalten. Die Krise trifft Alleinerziehende – die überwiegend weiblich sind – finanziell und psychisch besonders hart. Darüber hinaus sind Frauen, aber auch LSBTI*-Personen, durch die Kontaktbeschränkungen und häusliche Isolation besonderen Belastungen und Gefahren ausgesetzt. Für geflüchtete Frauen, die auf engem Raum in Gruppenunterkünften leben, ist die Situation besonders dramatisch: Sie sind einer hohen Ansteckungsgefahr in den engen Unterkünften ausgesetzt und leiden unter dem Wegfall von Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Frauen in der Coronakrise sprechen.
Braunschweiger*innen diskutierten über die Situation von Frauen und LSBTI* in der Coronakrise
Am Dienstag, den 26. Mai 2020, lud die AG Gender*Intersektional zu einer Videokonferenz ein, um über die aktuelle Lage von Frauen und LSBTI* in unserer Stadt zu sprechen. Die Vorstandsbeisitzende Margaux Jeanne Erdmann moderierte die Veranstaltung, an der gut 25 Braunschweiger*innen teilnahmen. Zum Einstieg in die Diskussion berichteten Marion Lenz (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Braunschweig), Elke Flake (Vorsitzende der Ratsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Mareike Walther (Anlauf- und Koordinationsstelle LSBTI* der Stadt Braunschweig) und Madina Rostaie (Geschäftsführung Refugium Flüchtlingshilfe e.V.) über die besonderen Herausforderungen für Frauen mit und ohne Migrationsgeschichte sowie LSBTI* in den letzten Wochen und Monaten.
Streit und Gewalt können in der häuslichen Isolation stärker eskalieren
Marion Lenz sprach über die begründete Sorge, dass Isolation und Kontaktbeschränkungen zu einem Anstieg häuslicher Gewalt führen könnten. Schließlich sind entsprechende Daten aus anderen Ländern bekannt. Ein frauenpolitischer Erfolg in der Coronakrise ist, dass die Stadt Braunschweig die Familienplätze im Frauenhaus von 12 auf 16 aufstocken konnte – und das innerhalb kürzester Zeit. Jeder dieser Plätze ist wertvoll, wenn es darum geht, Frauen und ihren Kindern in Notsituationen ein zu Hause zu bieten. Polizei und Beratungsstellen vermelden bisher zwar nicht mehr Fälle häuslicher Gewalt in Braunschweig – dies kann aber daran liegen, dass Frauen keine unbeobachteten Momente finden, um sich Hilfe zu holen oder sich überhaupt erst über Hilfsangebote zu informieren (Bundesweites Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016).
Rückfall in traditionelle Rollenmuster durch Home Office und Kinderbetreuung
Denn derzeit arbeiten viele Arbeitnehmer*innen von zu Hause aus, einerseits aus Infektionsschutzgründen, andererseits um ihre Kinder betreuen zu können. Dabei tragen vor allem Frauen die Doppelbelastung, denn viele Paare fallen in alte Rollenbilder zurück: selbst wenn der Vater der Kinder ebenfalls von zu Hause arbeitet, machen Frauen „nebenbei“ den Haushalt und tragen die mentale Last der Kinderversorgung.
Dieser Trend wird auch dadurch deutlich, dass mehr Frauen als Männer die Möglichkeit des Infektionsschutzgesetzes nutzen, sich mit 67% des Gehaltes zur Kinderbetreuung freistellen zu lassen. Und das betrifft nicht nur Familien, in denen Frauen weniger verdienen als Männer! Elke Flake erklärte, dass sich hierdurch die Gender Pay Gap und die Gender Pension Gap weiter vergrößern könnten. Das Recht von Frauen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist bedroht. Marion Lenz fasste diesbezüglich zusammen, dass wir unseren Blick darauf revidieren müssen, wie weit wir als Gesellschaft in der Gleichberechtigung wirklich sind. Im internationalen Vergleich sind wir unter anderem in Bezug auf die Kinderbetreuung sehr konservativ. Madina Rostaie berichtete, dass diese traditionellen Geschlechterrollen auch Zugewanderten aufgedrückt werden, indem beispielsweise Männer bei der Vergabe von Sprachkursen und Arbeitsplätzen bevorzugt werden, wohingegen Frauen zu Hause bei den Kindern bleiben sollen.
Insgesamt ist die Kindernotbetreuung in Braunschweig derzeit zu 20% ausgelastet, angestrebt sind 50%. Dabei gibt es stadtteilspezifische Unterschiede: in einigen Stadtteilen gibt es einen sehr großen Bedarf, da die dort lebenden Eltern langsam zurück an die Arbeitsplätze kehren. Die Diskussionsteilnehmer*innen kritisierten zudem, dass die Regelungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung von den Trägern abhängig sind. Hier sollte es einheitliche Standards geben! Besonders dramatisch ist die Betreuungssituation für Alleinerziehende, die überwiegend weiblich sind: Sie müssen die Kinderbetreuung allein stemmen und haben nur Anspruch auf Kindernotbetreuung, wenn sie die Hälfte ihres Urlaubs schon aufgebraucht haben.
Queere Personen leiden besonders unter der Isolation und dem Wegfall von Beratungsangeboten
Mareike Walther machte deutlich, dass auch LSBTI* in der Krise hart getroffen werden. Besonders für Jugendliche und Kinder, deren sexuelle Orientierung und/oder Identität zu Hause nicht akzeptiert werden, kann der Zugang zu persönlichen Beratungsangeboten auf Grund der erhöhten Gefahr psychischer und physischer Gewalt lebenswichtig sein. In den letzten Monaten mussten genau diese Angebote ausgesetzt werden. Aufgrund der Schulschließungen fielen zudem Schulbesuche von Organisationen, die sich für Aufklärung bezüglich der Rechte von LSBTI* einsetzen, komplett aus. Problematisch ist zudem, dass die Isolation zu gesundheitlichen Problemen führen oder diese verstärken kann. Obwohl in diesen Fällen dringend ärztliche Unterstützung notwendig ist, meiden viele queere Personen den Ärzt*innenbesuch, da medizinisches Personal oft nicht für den Umgang mit LSBTI* sensibilisiert ist. Dieses Problem wird durch die Coronakrise immens verschärft!
Um die Akzeptanz queerer Lebensweisen zu vergrößern und dadurch der Stigmatisierung sowie Diskriminierung entgegenzuwirken, müssen diese sichtbar gemacht werden. Doch wichtige Veranstaltungen, die die Sichtbarkeit von LSBTI* in unserer Gesellschaft erhöhen – wie der Christopher Street Day – werden dieses Jahr nicht stattfinden. Mareike Walther betonte, dass das die Problemlagen und Bedürfnisse von LSBTI*-Personen in der Stadtverwaltung noch unterrepräsentiert sind und forderte mehr Aufklärung bezüglicher queerer Personen – insbesondere im Gesundheitssystem.
Frauen in Asyl und Asylbewerberinnen in Sammelunterkünften: kein Sicherheitsabstand, keine Beratung, keine Sichtbarkeit
Zur Situation von Frauen in Asyl und Asylbewerberinnen sprach Madina Rostaie, Leiterin des Refugiums e.V., welches ebenfalls sein Beratungsangebot stark reduzieren musste. Aktuell finden keine Beratungen mehr in den Sammelunterkünften der Landesaufnahmebehörde statt, faktisch hatten die Menschen dort jetzt mehrere Wochen lang keinerlei Ansprechpersonen. Ehrenamtliche Strukturen um die Unterkünfte mussten sich zwischenzeitlich komplett zurückziehen. Immerhin konnte die Tatsache, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keine Bescheide mehr verschickte, die psychische Belastung für Viele teilweise reduzieren.
Auf der anderen Seite steht selbstverständlich die Tatsache, dass die Angst vor Infektionen mit dem Coronavirus vor allem in Sammelunterkünften aus guten Gründen besonders hoch war. In diesen Unterkünften sind auch in Nicht-Krisen-Zeiten vulnerable Personen aufgrund mangelnder Ausweichmöglichkeiten einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. In der Krisensituation wurden Kinderbetreuung und Beschulung eingestellt, gleichzeitig trauten sich viele Bewohner*innen aus Angst vor dem Virus nicht mehr aus der Unterkunft. Wer dann in einer Notsituation Unterstützung gebraucht hätte, konnte nur noch telefonisch mit Beratungsstellen in Kontakt treten. Genau das ist aber für viele geflüchtete Frauen ein Problem. Auch in Zukunft, wenn persönliche Termine nach und nach wieder erlaubt werden, spielt das Kommunikationsproblem eine zentrale Rolle: Selbst Muttersprachler*innen haben gelegentlich Probleme, sich beim Gespräch mit Mund-Nasen-Schutz zu verstehen. Wie soll es dann denen gehen, die die Sprache gerade erst lernen?
Als Kernproblem, welches selbstverständlich schon vor der Krise bestand, nannte Madina Rostaie die Wohnungssituation von Asylsuchenden. Die Unterbringung in Sammelunterkünften ist untragbar, gerade für Frauen und LSBTI*. Allerdings werden diese Problemlagen in der Krise kaum öffentlich thematisiert. Warum berichten unsere Medien ausführlich über die Problematik von Sammelunterkünften für Arbeiter*innen in der Fleischindustrie, nicht aber über die Lage der Geflüchteten?
Die Missstände haben sich nicht verändert – sie haben sich zugespitzt
Im Laufe der Diskussion wurde eines immer wieder klar: Alle besprochenen Probleme gab es auch schon vor der Coronakrise, aber nun verschärfen sie sich. Doch die geschlechterspezifischen Probleme sind im öffentlichen Diskurs aus verschiedenen Gründen kaum sichtbar: Frauen mit und ohne Migrationshintergrund sowie LSBTI*-Personen haben auf Grund ihrer Mehrfachbelastungen keine Zeit und Energie, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Sie haben Angst vor Diskriminierung und Stigmatisierung oder wissen schlicht nicht, wohin sie sich wenden können, da die verschiedenen Beratungsstellen ihre Angebote zeitweise eingestellt haben. Die Diskussionsteilnehmerin Christa Karras, langjähriges Mitglied im Präsidium des Bundesfrauenrates von Bündnis 90/Die Grünen, stellte angesichts dieser Schieflage einen Zusammenhang mit dem Mangel an Frauen an wichtigen Schaltstellen her. Denn dort wo Frauen Entscheidungen treffen, werden auch geschlechterspezifische Bedürfnisse berücksichtigt. Elke Flake und Marion Lenz riefen die Braunschweiger*innen dazu auf, sich über die derzeitigen Missstände öffentlich zu beschweren, denn viel zu oft heißt es, es beschwert sich ja niemand, dann kann die Lage auch nicht so schlimm sein. Zusammenfassend müssen die Probleme marginalisierter Gruppen sichtbarer werden. Wenn diese selbst keine Möglichkeit haben, sie in den politischen Diskurs einzubringen, müssen wir als engagierte Bürger*innen dies umso lauter tun. Wir müssen lautstark geschlechterspezifische Probleme in den Mittelpunkt stellen, um auf bestimmte Missstände aufmerksam zu machen – in der Coronakrise und auch danach. Denn diese Krise zieht ein verheerendes Folgeproblem nach sich: sie reißt ein Loch in die Finanzen der Kommune. Es besteht die große Sorge vor Kürzungen, die den Bereich Frauen, Migrant*innen und LSBTI* betreffen könnten. Wir dürfen nicht zulassen, dass mühsam aufgebaute Strukturen den finanziellen Kürzungen zum Opfer fallen. Wir müssen gemeinsam kämpfen und diese Debatte nach außen führen.
Ein Beitrag von Laura Häussler und Maren Klawitter für die AG Gender*Intersektional
/