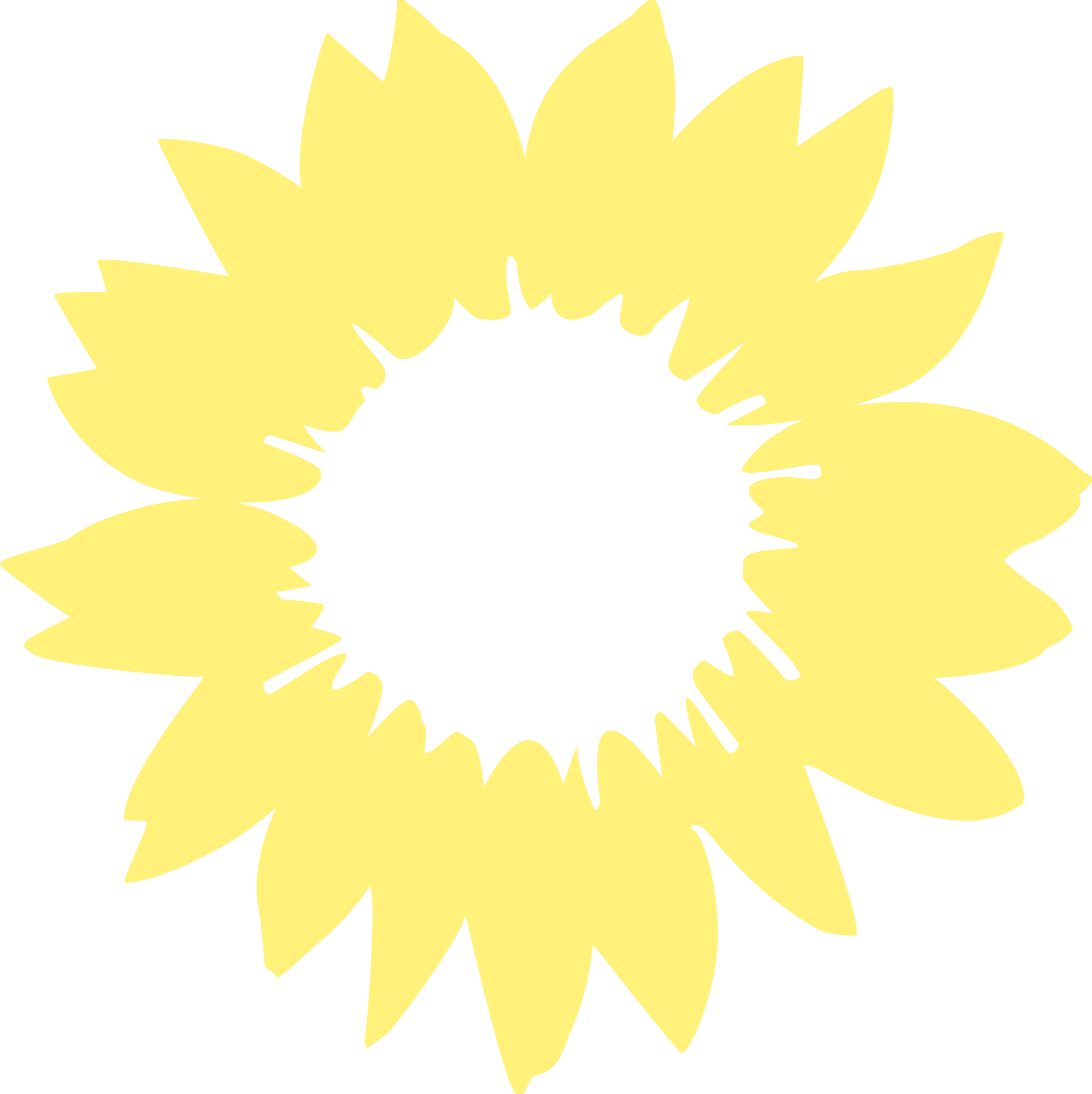Plädoyer für die Gleichbehandlung aller vor dem Krieg Geflüchteten
Erfahrungen mit einer Zwei-Klassen-Gesellschaft Geflüchteter
2015 wurden Geflüchtete aus Syrien von der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern willkommen geheißen („Willkommenskultur“!). Aktuell gilt das besonders für Geflüchtete aus der Ukraine. Der Grund damals wie heute: eine brutale Kriegsführung gegen die Bevölkerung. Der überwiegende Teil der Gesellschaft empfindet Mitgefühl mit Menschen, gegen die Krieg geführt wird und die deshalb ihre Heimat verlassen müssen. Sowohl 2015 als auch zu Beginn des Jahres 2022 wurden Geflüchtete an Bahnhöfen von ehrenamtlichen Helfer*innen willkommen geheißen und mit Notwendigem versorgt.
Wem diese Empathie zu Gute kommt, ist natürlich auch davon abhängig, worauf das mediale Hauptinteresse gerichtet ist. Afghanistan, wo vor allem Frauen durch die Taliban immer stärker ihrer Rechte beraubt werden und der Jemen, wo der Bürgerkrieg nicht weniger brutal als in Syrien wütet, stehen nicht mehr im Fokus der Berichterstattung und öffentlicher Diskussion. Das hat auch mit räumlicher Nähe bzw. Entfernung zu tun, aber nicht nur.
Wir beobachten als Folge, dass nicht alle Geflüchteten gleichbehandelt werden. Auch dann nicht, wenn die Ursachen ihrer Flucht vergleichbar sind, nämlich Unterdrückung, Gewalt und Krieg.
Blicken wir noch einmal auf 2015: Auf die Welle der Sympathie mit geflüchteten Syrer*innen folgte eine Phase der Verunsicherung, als die Herausforderungen zu wachsen begannen und staatliche Stellen mit der Bewältigung des Zustroms fremder Menschen überfordert waren. Der vehemente Protest gegen den Satz der damaligen Kanzlerin Angela Merkel „Wir schaffen das.“ veranschaulicht das. Manche sahen auch die Gefahr einer Konkurrenzsituation (z.B. um Arbeitsplätze, knappen Wohnraum, soziale Hilfen) zwischen bestimmten Bevölkerungsschichten und Geflüchteten. Diese Stimmung schlug sich in wachsenden Stimmenanteilen der rechtsextremen und fremdenfeindlichen Partei AFD bei Landtagswahlen nieder. Und die Regierung reagierte defensiv mit Restriktionen für Geflüchtete aus Syrien: Sie bekamen grundsätzlich nur noch einen subsidiären Schutz; Ausländerbehörden kontrollieren regelmäßig deren Aufenthaltsberechtigungen. Familienzusammenführungen wurden zunächst – bis auf streng begrenzte Ausnahmen – ausgesetzt und später kontingentiert. Noch unsicherer ist die Situation zahlreicher Geflüchteter aus anderen Ländern: Jahrzehntelange Kettenduldungen und auch Ausweisungen von gut integrierten Menschen sind nicht selten.
Da stellt sich die Situation ukrainischer Geflüchteter heute ganz anders dar. Am 4. März 2022 haben die EU-Innenminister*innen erstmalig in der Geschichte der Europäischen Union per Ratsbeschluss die Anwendung der Massenzustrom-Richtlinie entschieden. Mit diesem Beschluss erhalten Schutzsuchende aus der Ukraine europaweit Zugang zu Arbeit, Bildung sowie Sozialleistungen und medizinischer Versorgung, ohne vorher ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Natürlich ist das angesichts der katastrophalen humanitären Situation in der Ukraine begrüßenswert, aber warum hat man nicht schon 2015 die Massenzustrom-Richtlinie, die es seit 2001 gibt, auf syrische Geflüchtete angewendet, warum wurden und werden andere Geflüchtete nicht vergleichbar behandelt?
Regierungen reflektieren bei ihren Entscheidungen immer auch Stimmungen und Haltungen in der Bevölkerung. Man will wiedergewählt werden und nicht Stimmen an die AFD verlieren. Offensichtlich nimmt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland und anderen europäischen Ländern Geflüchtete aus der Ukraine als uns kulturell näher wahr als Geflüchtete aus dem arabischen oder dem afrikanischen Raum. Diskriminierungen von afrikanischen Student*innen an der ukrainisch-polnischen Grenze, über die mehrfach berichtet wurden, belegen das (vgl. Angriffskrieg auf die Ukraine: Rassismus auf der Flucht, aus: https://www.proasyl.de/news/angriffskrieg-auf-die-ukraine-rassismus-auf-der-flucht/, 20.05.2022). Diese Wahrnehmung wird durch Äußerlichkeiten, aber auch durch klischeehafte Vorstellungen über die arabische Kultur hervorgerufen.
Sogar eine rassistische Hierarchie bezüglich Geflüchteter liegt nahe. Als ehrenamtlicher Helfer für Migrant*innen erfahre ich (Martin SK) immer wieder von Betroffenen und über Dritte, wie z.B. afrikanische Pflegekräfte von Patient*innen Diskriminierungen aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft erleiden müssen. Auch wird berichtet, dass Wohnungen ganz plötzlich für Menschen aus dem arabischen Raum nicht mehr frei sind, wenn deren Herkunft aufgrund des Namens deutlich wird. Demgegenüber nennen Ukrainer*innen eher Beispiele großer Hilfsbereitschaft; viele sind sogar in Privatwohnungen aufgenommen worden.
Am Beispiel des Maliers Lamine Haidaran (Braunschweiger Zeitung vom 26.04.2022 unter der Rubrik „Thema des Tages“) soll die unterschiedliche Behandlung Geflüchteter in Deutschland veranschaulicht werden: Haidaran kam 2013 wegen eines Bürgerkriegs nach einer gefährlichen Flucht durch die Sahara und das Mittelmeer nach Deutschland. Er äußert Dankbarkeit für die Unterstützung, die er hier erhielt, besonders dafür, dass er seine Ausbildung zum Tiefbau-Facharbeiter abschließen konnte, und dafür, überhaupt hier leben zu können. Mittlerweile kann er sich selbst finanzieren. Aber sein Aufenthaltsstatus wird halbjährlich überprüft. Seine hart erkämpfte Freiheit habe einen „bitteren Beigeschmack“, äußert er. Denn Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bekommen hier eine Unterstützung, die er selbst nie hatte: unkomplizierte Einreise in die EU, Gratisfahrkarten für die Bahn, freie Wahl des Wohnortes, Zugang zu Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt. Er habe wie die Ukrainer*innen ein „Leben in Frieden und Freiheit“ angestrebt, sei aber ganz anders behandelt worden. Während Ukrainer*innen schnell und ohne bürokratische Hürden einen Zugang zum Arbeitsmarkt finden könnten, musste Haidaran sieben unbezahlte Praktika absolvieren, bevor er schließlich seine Lehrstelle bekam. Auch habe er vielfach Rassismus erfahren und komme nie in eine Diskothek herein. Trotzdem wolle er von solchen Erfahrungen nicht sein Leben bestimmen lassen und konzentriere sich auf die Arbeit. Trotz der genannten Erfahrungen gönne er den Ukrainer*innen jegliche Unterstützung, weil er niemandem das wünsche, was er erlebt habe.
Es stellt sich aus Grüner Sicht die dringende Frage, wie dazu beigetragen werden kann, dass sowohl staatliche Stellen als auch die Bevölkerung zukünftig den berechtigten Bedürfnissen aller Gruppierungen von Geflüchteten gerecht werden. Und wie das geschehen kann, ohne Vorurteile und Ängste in der deutschen Bevölkerung zu ignorieren bzw. einfach moralisierend „abzubügeln“. Letzteres würde langfristig nicht zu einer Verbesserung der Situation von Menschen wie Lamine Haidaran beitragen.
Wege zu einem gerechteren Umgang mit allen Geflüchteten
Die schnelle und umfassende Hilfe im Rahmen der Massenzustrom-Richtlinie für Geflüchtete aus der Ukraine ist neu und zeigt, wie gut Unterstützung in allen Lebensbereichen europaweit funktionieren kann. Angesichts der teilweise dramatischen Fluchterfahrungen und des daraus folgenden
unfreiwilligen Aufenthalts in einem fremden Land ermöglichen diese Rahmenbedingungen ein erstes Ankommen und ein Stück Normalität im Alltag.
Angesichts der vielen Herausforderungen, vor denen Geflüchtete stehen, stellt sich folgende Frage: Wie kann der Ungleichbehandlung von Gruppierungen Geflüchteter wirkungsvoll begegnet und so zu einer Verbesserung ihrer Situation beigetragen werden?
Denn diese Ungleichbehandlung ist nach dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes (Artikel 3 GG) sowohl rechtlich als auch ethisch nicht vertretbar. Diese Forderung lässt sich dadurch untermauern, dass alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und Ethnie zu Geflüchteten werden und darunter leiden können. Das ist ein verbindendes Element zwischen allen Gruppierungen Geflüchteter. Fluchterfahrungen sind auch in unserer Gesellschaft tief verankert und liegen für viele Familien nur wenige Generationen zurück, z.B. Flucht und Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkriegs und unmittelbar danach. Dafür zwei Beispiele:
Die 81-jährige Maria Bohm berichtet, wie sie als fünfjährige aus Serbien nach Niederbayern fliehen musste und bei einem Mann unterkamen, der von den Amerikanern gezwungen wurde ihre Familie unterzubringen. Sie schildert, wie sie sich zu fünft ein Zimmer teilten, zum Spielen nicht raus durften und alle mit einer Kelle aus dem Topf aßen. „Wir waren auf seine Gnade angewiesen.“ (vgl. „Meine Oma, der Flüchtling“)
Friedhelm Höckendorff (ꝉ) ist von Pommern nach Schleswig geflohen und berichtet, wie er oft als „Flüchtlingspack“ beschimpft wurde. Wie er vom Lehrer, einem kriegsversehrten Veteranen, vor der ganzen Schulklasse wegen seines schlechten Deutsch gedemütigt wurde. In einem provisorischen Barackenlager nahe des Schlosses Gottorf in Schleswig lebte seine Familie ganze drei Jahre. Der allgegenwärtige Hunger machte auch die Kinder erfinderisch und so gingen sie jagen und fischen, sammelten Beeren und Ähren (vgl. „Meine Oma, der Flüchtling“).
Diese Beispiele zeigen, dass Fluchterfahrungen bis heute in vielen Familien nachwirken und so das kollektive Gedächtnisses der Gesellschaft prägen. Das geschichtliche Bewusstsein, besonders junger Menschen, dafür zu schärfen, hilft die aktuelle Lage von Geflüchteten besser zu verstehen.
Wir Grünen setzen uns deshalb für eine Gleichberechtigung und damit verbunden gerechte Behandlung aller Geflüchteter in Deutschland ein, unabhängig von Hautfarbe, Ethnie und Kultur. Indem wir bei den Erfahrungen ansetzen, die Einheimische und Geflüchtete teilen, tragen wir zu mehr Empathie für Geflüchtete bei. Das dürfte wirkungsvoller sein als rein rational gegen Vorurteile und Ängste zu argumentieren. Vielmehr sollten wir verstärkt Begegnungen zwischen Einheimischen und Geflüchteten und das gegenseitige Zuhören fördern. Gerade das ist etwas, was Kommunen leisten können und das „Haus der Kulturen e.V.“ bietet in Braunschweig z.B. ein breit gefächertes Bildungsangebot, aber auch vielfältige Möglichkeiten solcher Begegnungen. Allerdings gibt es insgesamt in Braunschweig noch „Luft nach oben“, was die Ermöglichung von Begegnungen angeht. Es ist wichtig, dass die Kommunikation „auf Augenhöhe“ stattfindet, was besonders durch gemeinsame Ziele bei Aktionen und Projekten ermöglicht werden kann (z.B. Gartenprojekte, Kochaktionen, interkulturelle Lesungen etc.). Eine solche Alltagskommunikation kann dazu beitragen, dass man sich gegenseitig wertschätzen lernt und öffnet (vgl. Kontakt zwischen Geflüchteten und Einheimischen – wie kann man für die Entspannung von Beziehungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen sorgen? – Aus: https://www.fachnetzflucht.de/kontakt-zwischen-gefluechteten-und-einheimischen-wie-kann-man-fuer-die-entspannung-von-beziehungen-zwischen-verschiedenen-bevoelkerungsgruppen-sorgen/ (17.05.2022).
Konkret stellen sich in Bezug auf Geflüchtete weitere Fragen: An welche Punkten ist gesellschaftliche Veränderung nötig? Wie können wir schnelle und zielgerichtete Unterstützung einer größeren Gruppe geflüchteter Menschen zukommen lassen und Hürden abbauen? Wie ermöglichen wir mehr gesellschaftlicher Teilhabe?
Tragen wir also dazu bei, dass alle Menschen, die Zuflucht suchen, die Hilfen bekommen, die sie benötigen.
Quellen:
1. Braunschweiger Zeitung vom 26.04.2022 unter der Rubrik „Thema des Tages“
2. Angriffskrieg auf die Ukraine: Rassismus auf der Flucht – Aus: https://www.proasyl.de/news/angriffskrieg-auf-die-ukraine-rassismus-auf-der-flucht/, 20.05.2022
3. Meine Oma, der Flüchtling: Sechs Protokolle über die Flucht vor rund 75 Jahren, aus: Onlineredaktion der Süddeutschen Zeitung
https://jetzt.de/politik/meine-oma-der-fluechtling-sechs-protokolle-ueber-die-flucht-vor-70-jahren (17.05.2022)
4. Kontakt zwischen Geflüchteten und Einheimischen – wie kann man für die Entspannung von Beziehungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen sorgen? – Aus: https://www.fachnetzflucht.de/kontakt-zwischen-gefluechteten-und-einheimischen-wie-kann-man-fuer-die-entspannung-von-beziehungen-zwischen-verschiedenen-bevoelkerungsgruppen-sorgen/ (17.05.2022)
Begegnungen mit Menschen mit internationalem Hintergrund – was kann ich tun?
- Die Angebote des Hauses der Kulturen sichten und wahrnehmen
- International orientierte Feste und Begegnungsräume besuchen
- Straßenfeste organisieren bzw. daran teilnehmen und dazu Menschen mit internationalem Hintergrund einladen
- Programme migrantischer Organisationen (z.B. Vereine bestimmter Nationalitäten) wahrnehmen und an Veranstaltungen teilnehmen
- Welcome House Braunschweig in Kralenriede: „Schon vorbei zu kommen um einen Kaffe zu trinken ist eine Unterstützung, weil wir so unserem Ziel der Begegnung näher kommen.“
https://welcomehousebraunschweig.com/ - DRK-Sprungbrett gGmbH http://www.drk-kv-bs-sz.de/angebote/drk-sprungbrett-ggmbh/was-ist-die-sprungbrett-ggmbh.ht
- Freiwillig-engagiert http://www.freiwillig-engagiert.de/48-2/
Kathleen Hillis, Martin Schmidt-Kortenbusch (AG Flucht und Migration)